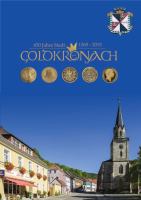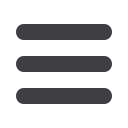
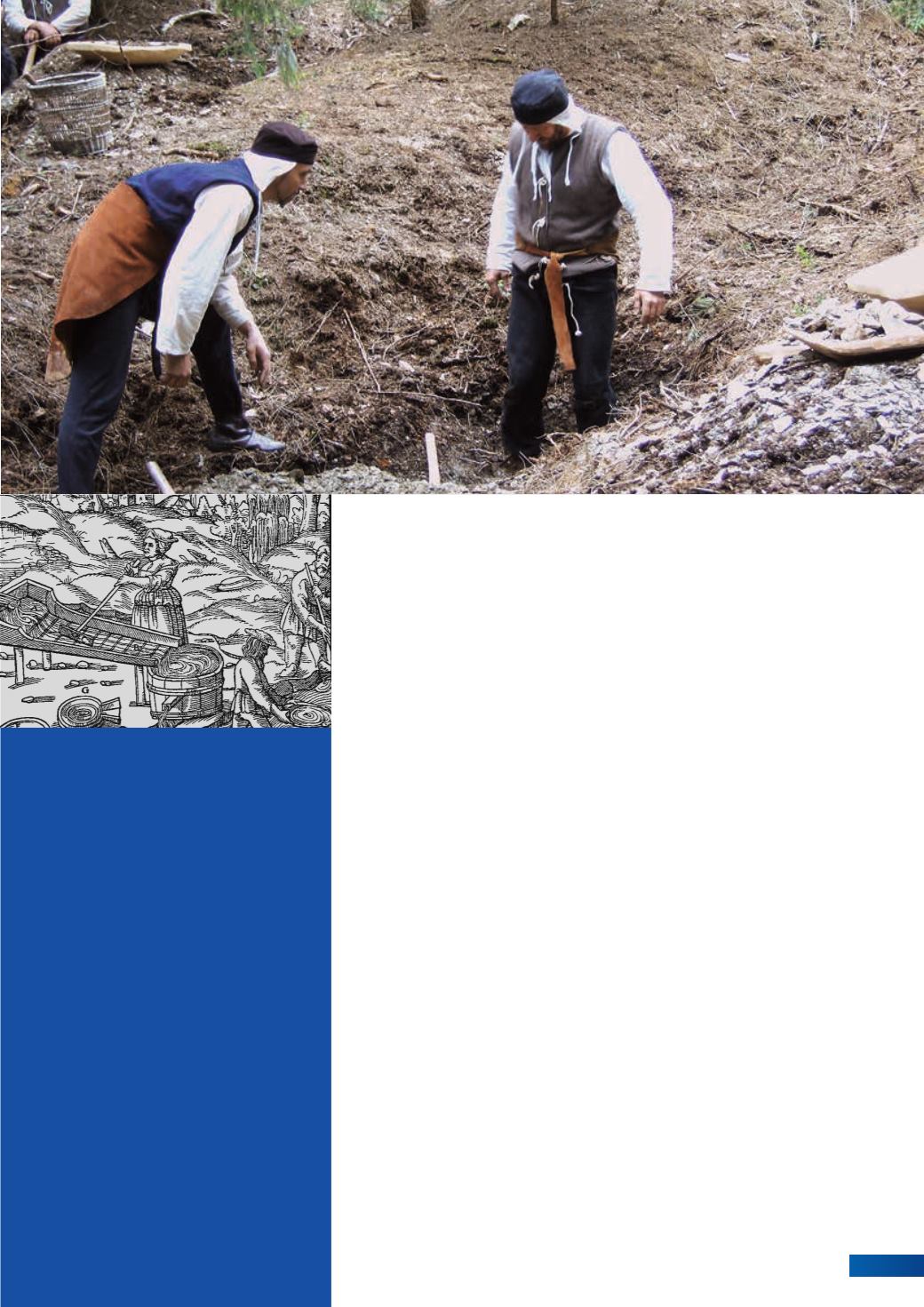
Um 1400 ist in keinem anderen Re-
vier auf deutschem Territorium neben
Zinn, Kupfer, Eisen und Nickel angeb-
lich so viel Gold und Silber gewonnen
worden wie in und um Goldkronach.
Der
„Schmutzlerschacht“
, der
„Na-
me-Gottes-Gang“
sowie der
„Oster-
tagsstollen“
sind um diese Zeit erst-
mals dokumentiert.
Nach der anfänglichen Blütezeit des
Goldbergbaus setzte im 15. Jahrhun-
dert jedoch der Niedergang ein, den
auch die ständigen Wiederbelebungs-
versuche der Landesherren nicht auf-
halten konnten. Die Beschaffenheit
des Bodens gab einfach nicht mehr
Gold her, die Vorräte waren erschöpft.
Man musste immer tiefer bohren, um
Gold zu finden. Um trotzdem noch an
Gold und Geld zu kommen, griffen die
Markgrafen auf fremdes Kapital zu-
rück. Sie gründeten
Gewerke
, Kapit-
algesellschaften. So kam es Ende des
15. Jahrhunderts noch einmal zu ei-
nem Aufschwung als durch zahlreiche
Nürnberger Kaufleute und Bürger im-
mer wieder zahlreiche neue Bergwerke
gemutet (eröffnet) wurden. Immer wie-
der gab es danach kurze Erfolge, immer
wieder kamen die Einbrüche, trotz inno-
vativer Sachverständiger, trotz moder-
ner Techniken, trotz moderner Werke.
Für einen dieser Aufschwünge sorgte
Ende des 18. Jahrhunderts Alexander
von Humboldt (siehe
Seite 24).
Im Jahr 1861 kamder Goldbergbau wie-
der zumStillstand. Als kurze Zeit später
dieWohnungen der Beamten an Privat-
leute verkauft wurden, war das Ende
des staatlichen Goldbergbaus nach gut
500 Jahren für alle sichtbar und be-
siegelt. Private Unternehmen suchten
trotzdem weiter, mit mäßigem Erfolg.
Hoffnung brachte 1920 die
Bergbau
Fichtelgold Aktiengesellschaft
, die
aber 1925 ihre Anstrengungen wieder
einstellte. Und auch Schürf- und Bohr-
arbeiten in den 1970er Jahren brachten
keine brauchbaren Ergebnisse.
Der Hauptort des Goldkronacher
Bergbaureviers zwischen dem
Weißen Main imNorden und dem
Seelohbach imSüden war Brand-
holz, der Hauptgang lag amGold-
berg. Es gab mindestens 20 Ze-
chen und ein dutzend Erzgänge.
Die bekannte Fürstenzeche war
rund einen Kilometer lang.
23