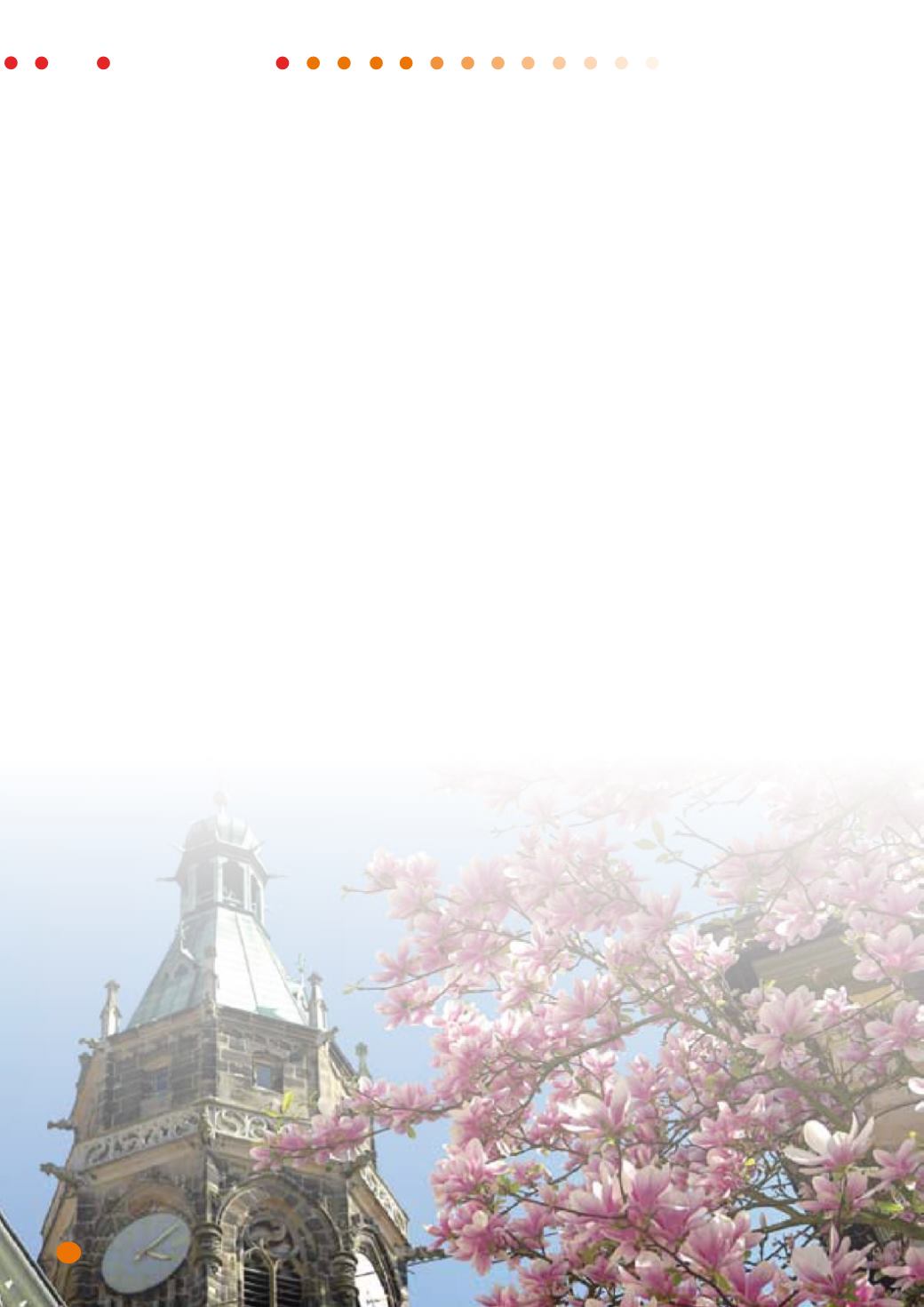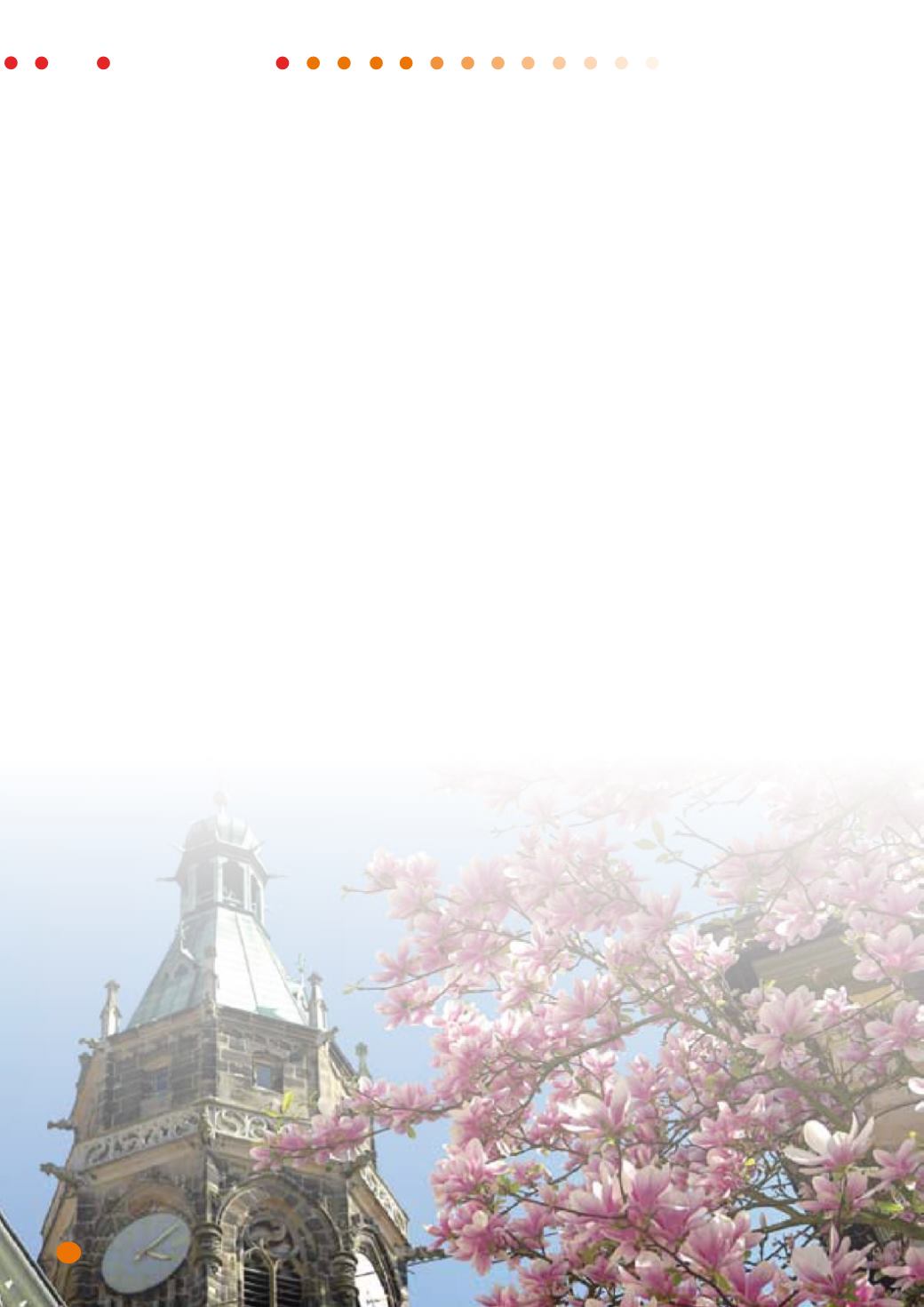
Wohnen in Roth
Gleich hinter der alten Stadtmauer steht das
Seckendorffschlösschen
(Hilpoltsteiner Straße
2a). Oberamtmann Robert von Seckendorff hat
es sich in der Neuen Vorstadt am Neuen Tor im
Jahr 1768 gebaut. Von 1884 bis 1937 war es
Krankenhaus
, seit 1989 finden dort
Volkshoch-
schulkurse
statt.
Biegt man bei der Buchhandlung Feuerlein links
ab, kommt man auf den
Kirchplatz
, der domi-
niert wird von der
Stadtkirche
und dem
Neu-
en Rathaus
. Das Neue Rathaus an der Ecke zur
Hauptstraße war früher eine
Schule
, seit 1903
sitzt hier die Stadtverwaltung. Im 16. Jahrhun-
dert stand an gleicher Stelle das
„Freihaus“
von
Endreß von Hausen. Der Vertreter der Markgra-
fen in Roth hatte keinen Sohn und so verkaufte
er den Besitz an den Markgrafen. Der erklärte
ihn auf Lebzeiten
„frei von allen bürgerlichen
Lasten“
. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648)
war in dem prachtvollen Bau mit aufwändigen
Freskenmalereien und einer Hauskapelle für
einige Jahre die Rother Münzstätte unterge-
bracht. Im Jahr 1831 haben die Rother das Ge-
bäude abgerissen und eine Schule dort errich-
tet. Das Rathaus ist durch einen Glastunnel mit
dem
ehemaligen Feuerlöschgerätehaus
ver-
bunden, das heute auch Teile der Verwaltung
beherbergt.
Gegenüber vom Neuen Rathaus, mitten auf dem
Kirchplatz steht sie, die
Evangelische Stadtkir-
58
che
(1511-1513). Wahrscheinlich gab es schon
viel früher eine Kirche. Seit wann diese Kirche
dort aber stand, ist nicht sicher. Sicher ist nur,
dass in den
Eichstätter Salbüchern
im
Jahr 1345
eine Kirche an der Südseite des Flusses Roth ge-
nannt wird, und dass am Turm dieser Kirche im
Jahr 1357 eine Glocke aufgehängt wurde, die
der Heiligen Maria geweiht war. Die Kirche, wie
sie heute dort auf dem Kirchplatz steht, sieht
von außen noch fast genauso aus, wie sie der
Steinmetz Endres Embhart und seine Arbeiter zu
Beginn des 16. Jahrhunderts umgebaut haben,
als einen spätgotischen Bau mit romanischen
Elementen. Damals erhielt die Kirche noch das
Patrozinium „Zu unserer lieben Frau“
. Das In-
nere der Kirche ist im Laufe der Jahrhunderte
des Öfteren wesentlich verändert worden. So
machte Baumeister Johann David Steingru-
ber im markgräflichen Auftrag die Kirche von
1732-1738 zu einer Saalkirche im ansbachi-
schen Stil, das gotische Gewölbe wurde zum
Beispiel entfernt, eine flache Decke kam rein.
Außerdem wurde die Kirche im
„Markgrafenstil“
umgebaut. Dabei war die Anordnung von Altar,
Kanzel und Orgel genau geregelt: der Kanzel-
alter stand an der Ostwand, darüber kam die
Orgel. Und Steingruber setzte der Kirche mit ei-
nem für ihn typischen achteckigen Turm seinen
Stempel auf. Dieser Turm verbrannte allerdings
beim großen Stadtbrand 1878, danach wur-
de die Kirche immer wieder modernisiert und
umgestaltet. Der Kanzelaltar kam weg, ebenso
1